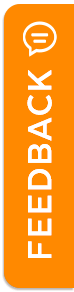Der Bericht von der Verklärung Jesu zu Beginn von Kap. 17 ist von großer Bedeutung. Hier werden mindestens vier wichtige Dinge gelehrt:
1) die Kontinuität, in der Jesus steht (er steht dort mit den zwei wichtigen Personen des AT, Mose und Elia);
2) das Bekenntnis des Vaters zu seinem Sohn (Jesus ist der eine geliebte Sohn, an dem Gott der Vater perfekten Wohlgefallen hat);
3) das Ziel, auf das sich Alles zubewegt (die Herrlichkeit, die hier schon mal kurz sichtbar wird);
4) die Vorrangstellung und Exklusivität Jesu (die Jünger sollen auf Jesus hören … und sehen dann „niemand als Jesus allein“ siehe Vers 8)
Wir sehen hier also in der historischen Situation vor der Kreuzigung, wie sich alles zusammenfügt. Mose und Elia als zwei große Repräsentanten des AT stellen sich zu Jesus. Sie bezeugen hier also IHN und dann spricht Gott der Vater selbst und hebt Jesus hervor als den einen „lieben Sohn“.
Ab Vers 10 zeigt uns dieser Bericht noch etwas wirklich Spannendes. Die Jünger fragen nach Elia … und Jesus sagt, dass dieser gekommen sei. Er bezieht sich hier auf Johannes den Täufer. Dieser ist natürlich nicht im engsten Sinne der historische Elia … aber er ist der „verheißene Elia“ – der legitime Nachfolger des entrückten Elia und so wird hier deutlich, dass die AT Verheißung aus dem Propheten Maleachi symbolisch/typologisch zu verstehen sind. Es geht nicht um die Person, sondern die Funktion. In gleicher Weise lehrt uns die Bibel ja auch z.B. über den neuen Tempel oder das Opferlamm … Jesus ist beides und doch ist er natürlich nicht wortwörtlich ein Bauwerk oder ein Lamm.
Jesus hilft uns somit, AT Verheißungen besser zu verstehen und zu erkennen, dass sie tatsächlich im Kommen, Sterben, Auferstehen und Wiederkommen des Christus ihre Erfüllung finden – in IHM finden alle Gottesverheißungen ihr Ja und Amen.
Als Jesus vom Berg der Verklärung zurückkommt, kommt es zu der Begegnung mit dem „mondsüchtigen“ Knaben, den die Jünger nicht heilen konnten. Die Jünger haben wohl recht unabhängig von Gott agiert. In Parallelstellen wird ja berichtet, dass Jesus lehrte, dass Gebet und Fasten notwendig wären. Und hier kritisiert er den Kleinglauben der Jünger.
Scheinbar haben die Jünger versucht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen – wahrer Glaube agiert aber aus festem Glauben nicht in unsere eigenen Fähigkeiten, sondern in Abhängigkeit von Gott.
- Es geht eben nicht darum, dass wir die „richtigen“ Strategien und Methoden anwenden, sondern, dass wir darauf vertrauen, dass Gott selbst Alles zu tun vermag. Und so beten wir „Dein Wille geschehe“ … aber auch „Herr, erbarme Dich“.
Dann erklärt Jesus zum zweiten Mal, was ihm bevorsteht. Die Jünger müssen darum wissen, dass Jesus sie bald verlassen wird. Das ist aber kein Aufruf zur Unabhängigkeit, sondern zu einer neuen Form von Abhängigkeit – zu einem Glauben, der das sieht, was nicht (mehr) vor Augen ist und auf den unsichtbaren Gott vertraut, der alles tun kann.
- Ich wünsche uns diesen Glauben!
Schließlich berichtet Matthäus von der Frage nach der Legitimität der Tempelsteuer. Als Sohn Gottes hätte Jesus streng genommen ja eigentlich keine Tempelsteuer zahlen müssen – er ist ja der Tempel, der durch den Bau in Jerusalem nur schattenhaft abgebildet wurde. Aber es geht ihm nicht darum, sein Recht durchzusetzen – aus diesem Grund will er (und sollten wir) keinen Anstoß erregen. Er weiß darum, dass Gott uns eines Tages Recht verschafft und hier auf Erden für uns sorgt. Das wird hier auf faszinierende Weise durch den Fisch deutlich, der die Tempelsteuer zur Verfügung stellt.