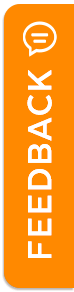Ab Matthäus 22,15 lesen wir davon, wie die Pharisäer mit dem Ziel zu Jesus kommen, ihn dazu zu bringen, sich gegen den Kaiser zu wenden. Das ist ja naheliegend, da er in dem Gleichnis sich ja gerade selbst quasi als König bezeichnet hat. Doch Jesus lässt sich nicht austricksen. Seine Antwort: „So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“ ist sehr weise.
Vordergründig klingt es so, als wenn Jesus deutlich macht, dass der Kaiser und Gott auf verschiedenen Ebenen Anspruch an uns haben, so dass Treue zu Gott nicht in Konkurrenz zur Treue dem Kaiser gegenübertritt. Aber von der Prägung der Münze her kommend wird klar: da wir in Gottes Abbild geschaffen wurden, sollten wir uns voll und ganz Gott hingeben. Das bedeutet dann aber natürlich auch, dass wir die Autoritäten anerkennen, die Gott über uns gestellt hat (Röm 13,1ff).
- So möchte ich uns alle ermutigen, für den König zu leben und dann auch die zu ehren, die Gott als Autoritäten in unser Leben bringt.
Matthäus fährt fort mit Berichten von Versuchungen, die Jesus über sich ergehen lassen musste. Die Sadduzäer sind sich sicher, dass es keine Auferstehung der Toten gibt und kommen mit ihrer Lieblingsfrage, um den Anhängern der Auferstehung der Toten die angebliche Absurdität dieser Position aufzuzeigen.
Wie schon die Pharisäer zuvor, als diese über den Zinsgroschen fragten, erleben nun auch die Sadduzäer, dass sie keine Ahnung haben. Sie haben einfach einen grundsätzlichen Denkfehler in ihrer Fragestellung, nämlich, dass die Auferstehung der Toten Menschen zurückbringt, in quasi identische Lebensumstände. Doch das Leben nach dem Tod ist grundlegend anders und es gibt keine Ehe mehr. Aber noch grundlegend problematischer ist, dass die Sadduzäer die Kraft Gottes verkennen, der Macht über den Tod hat und ein Gott der Lebenden ist. Das Grundproblem ist also die defizitäre Gotteserkenntnis der Sadduzäer.
- Ich denke, dass viele theologische Fragen auch bei uns damit zusammenhängen, dass wir ein defizitäres Verständnis von Gott haben und oft Dinge viel zu menschlich betrachten.
- Ich kann uns da nur ermutigen, immer wieder Gottes Wort zu uns sprechen zu lassen und dann die Dinge, die uns schwer oder widersprüchlich erscheinen, einfach erst einmal stehen zu lassen.
Dann werden wir auch das tun, was Jesus dann als das höchste Gebot lehrt, nämlich Gott zu lieben. Gott zu lieben heißt ja gerade auch, seine Worte dankbar anzunehmen.
Gerade das wird uns dann auch dazu bringen, andere Menschen zu lieben, denn das ist ja der klare Auftrag, den wir durch Gottes Wort erhalten.
Schließlich offenbart sich Jesus als der Davidsohn, der gleichzeitig auch der Herr Davids ist. Er lässt keinen Zweifel, dass er der Christus ist, der Sohn von König David, der rechtmäßige und ewige König und Herr, den wir lieben und ehren sollen, der uns Kraft seiner Autorität beruft und uns ewiges Leben schenkt und der uns bedingungslos liebt und dazu befähigt, Gott und die Menschen zu lieben.
Zu Beginn von Kapitel 23 sehen wir, dass Jesus keine klaren Worte scheut und die Dinge beim Namen nennt. Hier redet er gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sein Vorwurf ist dabei evtl nicht in allen Dingen auf den ersten Blick sofort verständlich. Klar ist, dass er ihnen ihre Scheinheiligkeit und ihre bösen Herzen vorwirft. Aber er geht ja noch weiter und kritisiert auch das, was sie lehren, da sie den Menschen „schwere und unerträgliche Bürden… auf die Schultern“ legen. Gleichzeitig sagt Jesus den Menschen, „was sie euch sagen, das tut und haltet“.
- Die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs ist darin zu finden, dass Jesus die Pharisäer nicht dafür kritisiert, dass sie das Gesetz des Moses lehren, sondern dafür, was sie daraus machen. Die Pharisäer lehren Gerechtigkeit durch Werke … und diese Last kann keiner Tragen.
- Sie vernachlässigen hingegen das, was wahrhaft gerecht macht – die Lehre von der Gnade Gottes und den Aufruf zum Glauben.
- Das Lehren biblischer Gebote ist gut und richtig … aber eben niemals als Heilsweg.
Jesus kritisiert also die Heuchelei und den Umstand, dass solche Menschen in ihrer Selbstgerechtigkeit schon immer den Boten Gottes im Weg standen.
- Ich denke, dass wir gut daran tun, uns diese Lehren zu Herzen zu nehmen. Ein Streben nach Gerechtigkeit und Frömmigkeit ist gut und richtig, aber es sollte nie den Blick darauf versperren, dass wir und alle Anderen auch letztendlich voll und ganz von der Gnade Gottes abhängig sind, die wir nur durch den Glauben erfahren, der uns zur Gerechtigkeit gerechnet wird, gerade auch da, wo wir mal am Gesetz scheitern.
In den letzten Versen des Kapitels sehen wir dann, dass Jesus trotz all seinen harten Worten, ein liebender Herr ist, den es tief betrübt, dass die Menschen IHN ablehnen und die Rettung nicht wollen.
- Ich wünsche uns den Mut, biblische Wahrheiten so klar und deutlich zu sagen … und die Menschenliebe, dies eben nie mit kaltem Herzen zu tun, sondern um Jeden zu ringen!
Matthias Lohmann vor 4 Jahren