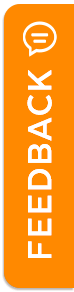Das Gleichnis zu Beginn von Kapitel 16 wirft sicher auch einige Fragen auf. Hier wird ein unehrlicher Verwalter gelobt und ein scheinbarer Auftrag erteilt, ähnlich zu handeln: „Lk 16:9 Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten.“
Letztendlich geht es wohl darum, dass wir die Dinge dieser Welt immer großzügig zum Wohle Anderer einsetzen sollen, da wir eines Tages selber davon abhängig sein werden, dass Gott uns gnädig und barmherzig annimmt.
Überhaupt geht es dann weiter darum, wie man mit Besitz umgehen soll. Treue und Großzügigkeit sind dabei die großen Stichworte. Beides haben die Pharisäer nicht … und eben auch nicht der reiche Mann, der den Lazarus ignoriert hatte.
Dabei wird dann auch deutlich, dass es keinen Weg aus der Hölle gibt. Der Tod markiert den Punkt, an dem das ewige Schicksal feststeht. Die Kluft ist dann unüberbrückbar (16,26).
Interessant ist dabei auch, auf wen die Menschen hier auf Erden hören müssen … eben nicht auf zurückgesandte „Verstorbene“, sondern auf Mose und die Propheten. Das klingt auch schon zuvor bei Jesu Worten an die Pharisäer durch (16,17)
- Wir tun gut, auf Gottes Wort zu hören … denn es weist uns den Weg zum ewigen Leben. Den Zugang können wir uns nicht erkaufen, sondern wir müssen ich durch den Glauben an den alleinigen Retter Jesus Christus geschenkt bekommen!
Zu Beginn von Kapitel 17 lesen wir verschiedene Lehren Jesu.
Er kündigt an, dass es Verführungen geben wird und warnt die Verführer (17,1-2), er ruft Christen auf, einander zurecht zu weisen, wenn das nötig ist und dann immer wieder bereit dazu zu sein, einander zu vergeben (3-4), er lehrt über die Kraft wahren Glaubens (5-6), erklärt, dass wir hier auf Erden zuerst einmal Knechte Gottes sind und Gott gegenüber keine Forderungen zu stellen haben (7-10) und ermahnt zu Dankbarkeit für die erlebte Heilung (Rettung), durch die sich unser Glaube offenbart, durch den wir gerettet werden (11-19).
- Insbesondere die Worte zum „Knechtslohn“ (7-10) sind eine harte und zugleich ganz wichtige Erinnerung, da wir Menschen uns tendenziell um uns selbst drehen und aus dem Blick verlieren, wem alle Ehre gebührt!
Und dann (ab Vers 20) spricht Jesus direkt über das kommende Gottesreich. Hier sehen wir sehr deutlich die Lehre vom „schon jetzt und noch nicht“. Das Reich ist schon da aber es breitet sich eher im Verborgenen aus. Mit jedem Menschen, der zum Glauben und damit unter die Herrschaft von König Jesus kommt, breitet sich sein Reich aus. Aber eines Tages wird Jesus sichtbar wiederkommen und dann kommen mit IHM das Gericht und die Fülle des Reichs. Und das wird nicht still und leise geschehen, sondern sehr deutlich sichtbar.
- Wer diese Passage liest kann meines Erachtens kaum an eine „geheime Entrückung“ glauben.
- Außerdem klingt es für mich so, als wäre das Kommen Jesu der Zeitpunkt zu dem sowohl die Erlösung der Gläubigen kommt (ihre dem Herrn „Entgegenrückung“) und das Gericht über die Ungläubigen (so wie das ja auch schon Schattenhaft zur Zeit Noahs und Lots kam).
Vor allem aber ist es wichtig, dass wir immer wieder daran erinnert werden, DASS JESUS wiederkommt. Das „Wann“ und „Wie“ sind zwar spannende Fragen ABER von größter Bedeutung ist vor allem der Fakt, dass er wiederkommen wird!
In Kapitel 18 lehrt uns Jesus, wie wir zu Gott kommen sollten.
In den ersten beiden Gelichnissen geht es um das Beten. Das Gleichnis von der bittenden Witwe und dem nicht-gottesfürchtigen Richter mag im ersten Moment ähnlich seltsam klingen, wie das Gleichnis in Kapitel 11 vom bittenden Freund (11,5ff). Der Punkt ist hier jeweils, dass Gott doch noch viel mehr und eher bereit dazu ist, den Bittenden zu helfen. Von daher sollten wir Gott beharrlich bitten. Genau das erklärt Lukas uns ja auch schon in Vers 1: „Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten.“
Ab Vers 9 lehrt Jesus dann durch das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer, dass unser Gebet aus einer Haltung der Demut kommen sollte. Wir kommen nicht fordernd und erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört, weil wir so toll sind, sondern wir kommen in Demut im Wissen darum, dass wir von Gott gar nichts fordern können und einfach Bittsteller sind.
Ab Vers 15 illustriert Jesus diese Haltung durch Kinder, die zu ihm gebracht wurden und dann wohl in seine Arme liefen. Sie kommen einfach voll Vertrauen – nicht auf sich selbst und ihren Wert bedacht, sondern einfach voll kindlichem Zutrauen.
- So sollten wir zu Gott kommen.
Auch der Bericht über den reichen Jüngling illustriert diesen Punkt – dieses Mal nur von der anderen (negativen) Seite. Der reiche Jüngling kommt mit viel „Selbstvertrauen“ und fragt, was er tun müsse. Er denkt also, dass er etwas tun könne, um in das Reich Gottes zu kommen.
Jesus zeigt ihm anhand der Gebote seine Limitationen, doch der Jüngling erkennt diese nicht und meint, die Gesetze gehalten zu haben. Dann wird Jesus deutlicher, indem er ihm klar sagt, was sein Götze ist, den er dem HERRN vorzieht, nämlich sein Reichtum. Und nun geht der Jüngling tatsächlich davon.
- Das sollte uns eine Warnung sein und uns dazu bringen, uns zu hinterfragen.
- Gibt es einen Götzen oder eine Lieblingssünde, die wir nicht bereit sind, loszulassen?
Die Jünger sind schockiert, denn der reiche Jüngling schien doch so gut dabei zu sein. Er hatte es zu etwas gebracht, sicher aus gutem Elternhaus, klug, erfolgreich und auch noch sehr moralisch. Und er war voller Ehrerbietung zu Jesus gekommen. Doch gerade solche Leute tun sich oft schwer damit, ihre eigene Schuld und Hilfsbedürftigkeit zu erkennen.
Jesus erklärt dann, wer überhaupt zu Gott kommen kann. Aus eigener Kraft kann das niemand. Es bedarf des gnädigen Eingreifens Gottes.
- Die Jünger offenbaren durch ihre konsequente Nachfolge, dass sie genau das erlebt haben.