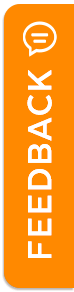Petrus schreibt an „auserwählte Fremdlinge“, die in verschiedenen Teilen der heutigen Türkei leben. Fremdlinge sind sie wohl primär deshalb, weil ihre wahre Heimat eben nicht auf Erden ist. Ob sie in den Regionen selbst auch in der Hinsicht Fremdlinge sind, weil sie ursprünglich woanders herkommen und ggf vertriebene Juden sind, lässt sich nicht definitiv beantworten. Aber in Hinblick auf das, was Petrus in Kapitel 2,9-10 & zu Beginn von Kapitel 4 schreibt, denke ich das eher nicht. Außerdem wäre es fast etwas seltsam, wenn Petrus nur Vertriebenen schreibt und nicht auch denjenigen, die dort als Einheimische zum Glauben gekommen sind.
Wie dem auch sei, Petrus beschreibt diese Menschen als „Auserwählte“ und erklärt dann in Vers 2, dass diese „Auserwählung“ einhergeht damit, dass sie von Gott dem Vater „ausersehen wurden“. Worum es Petrus hier geht ist, dass Gott derjenige ist, der diese Menschen letztendlich zu Fremdlingen in der Welt gemacht hat, und sie durch Jesu Blut und den Heiligen Geist zum Gehorsam gegenüber dem Evangelium (Glauben) und zur Heiligung bestimmt hat. Diese Bestimmung entlässt den Menschen aber andererseits nicht aus der Verantwortung, sich auch aktiv darum zu bemühen.
Petrus schreibt an Christen, die für ihren Glauben leiden müssen und letztendlich betont Petrus nun, dass diese Christen von Gott errettet wurden und er sie auch entsprechend seines Planes zur vollkommenen Heiligung bringen wird.
Das wird dann auch ab Vers 3 deutlich. Das Lob für die Wiedergeburt geht an Gott … d.h. Gott ist wiederum eindeutig der Akteur. Die Wiedergeburt ist nicht nur ein guter Start, sondern führt auch mit Sicherheit zu einem guten Ende, denn es ist eine Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung und zu einem sicheren Erbe, das alle Christen erhalten werden, denn der Glaube, den Gott uns geschenkt hat, bewahrt uns zur Seligkeit.
Petrus macht ab Vers 6 deutlich, dass es auch eine Form des Glaubens gibt, der nicht rettet. Zeiten des Leidens sind deshalb Zeiten, in denen erkennbar wird, ob unser Glaube echter, kostbarerer und somit definitiv rettender Glaube ist – denn dieser Glaube vertraut auf die Ewigkeit.
In den Versen 9-12 betont Petrus dann, dass der Inhalt dieses Glaubens die Person und das Werk des Herrn Jesus Christus ist. Nach der Erkenntnis des Evangeliums haben schon die Propheten gesucht und davon haben sie geweissagt. Damit sind sie unsere „Diener“, denn durch sie verstehen wir heute besser, was wir von Jesus wissen und worauf die Propheten zu ihrer Zeit noch hoffen mussten.
- Interessant ist dabei zu verstehen, was Petrus uns hier über die (AT) Propheten schreibt. Sie weisen auf Christus hin und somit sind ihre Worte für uns Christen gut und hilfreich. Petrus zeigt uns hier unsere privilegierte Stellung und eben auch, welche wichtige Rolle die Propheten für uns haben.
- Sie sind zusammen mit den Aposteln das Fundament der Gemeinde (Eph 2,20).
Nachdem Petrus in den ersten 12 Versen deutlich gezeigt hat, dass Christus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, führt Er uns nun vor Augen, dass uns Christen diese großartige Erkenntnis niemals passiv werden lassen sollte. Gerade weil wir durch Gottes Gnade gerettet wurden, sollen wir nun auch in dieser Gnade leben.
- Petrus ruft uns dazu auf, diesem Ziel mit aller Kraft entgegen zu streben. Genau das kommt in Vers 13 zum Ausdruck.
- Ich befürchte, dass das Streben nach Heiligung viel zu oft als optional angesehen wird. Dabei ist es unser klarer biblischer Auftrag. Interessant ist in diesen Versen, wie Petrus in seinen Worten zuerst vom Wirken Gottes spricht und dann zu unserem Auftrag wechselt und dann dieses wieder rückkoppelt zu dem was der HERR in Jesus Christus für uns getan hat, den er ehe Grundlegung der Welt dazu ausersehen hatte (ausgewählt … nicht nur in die Zukunft sehend erkannt) um uns mit seinem teuren Blut zu erkaufen.
Die Erlösung wird hier als etwas beschrieben, dass für die Christen definitiv bei Jesu Tod geschehen ist. Dabei kam unsere Wiedergeburt, die aus Gottes Barmherzigkeit geschah (V.3) durch das ewige und lebendige Wort Gottes. Ich denke, dass wir gut daran tun, uns klar zu machen, was Petrus uns hier über Gottes Wort lehrt. Es ist ein ewiges und lebendiges Wort, d.h. es ist heute genauso aktuell, wie vor 2000 oder vor 4000 Jahren. Es lebt und wirkt deshalb in unserem Leben.
- Wenn wir erkennen, mit was wir es bei der Bibel zu tun haben, werden wir immer mehr darin forschen und dieses Wort immer mehr weitergeben. Denn alle unsere Worte werden niemals die Qualität haben, wie das Wort Gottes und die Wiedergeburt kommt eben auch nicht aus schlauen menschlichen Worten, sondern aus dem lebendigen Wort Gottes.
- Ich wünsche uns allen, dass wir diese Kraft von Gottes Wort tagtäglich erleben!
Zu Beginn des 2. Kapitels lesen wir einen Appell zu einem Gott-gefälligen Leben. Gottes Wort hat uns nicht nur die Wiedergeburt gebracht, es ist eben auch lebendig und erbaut die Gläubigen … es ist die vernünftige, lautere Milch, die wir trinken sollten. Jesus Christus ist das Wort, und zu Ihm sollen wir kommen. Das tun wir, indem wir die Bibel lesen und uns dem Herrn im Gebet zuwenden.
Dann folgt eine weitere Betrachtung dessen, was der HERR für uns getan hat. Gott der Vater hat seinen Sohn, entsprechend seiner Verheißung, zum Grundstein gemacht, auf dem wir Christen bzw die Gemeinde erbaut wird. Und so wie Christus ein lebendiger Stein ist, so sollen auch wir als lebendige Steine mit erbaut werden, so dass wir als Tempel des Heiligen Geistes geistliche Opfer bringen.
Während Jesus sich auch mal selber als den „Tempel“ bezeichnet und Paulus lehrt, dass wir Gläubigen auch individuell ein Tempel Gottes sein sollten, in dem der Heilige Geist wohnt, spricht Petrus hier von der Gemeinde als Tempel. Als Christen sollten wir uns in die Gemeinde einfügen. Das ist unsere Berufung. Steine, die nicht eingebaut werden, erfüllen letztendlich nicht ihren Zweck.
- Von daher hoffe ich, dass niemand seinen Glauben längerfristig ohne die Einbindung in eine feste Gemeinschaft lebt, in der er sich einbringen kann
Petrus setzt dann seine Betrachtung des Psalm 118 Zitats fort und beschreibt dabei, wie sich an Christus letztendlich die Geister scheiden. Er ist für Manche ein Stein des Anstoßes und für Andere aber eben der Eckstein, auf dem sie erbaut werden, je nach Bestimmung & Erwählung.
Als Christen sind wir das, was im AT nur von Israel gesagt werden konnte und noch mehr. Nicht nur, dass wir, die wir einst nicht ein Volk waren, nun Gottes Volk sind und Seine Gnade erfahren haben, wir sind nun alle auch eine königliche Priesterschaft! Das ist bemerkenswert, denn in Israel, waren das Königshaus und das Priestergeschlecht klar voneinander getrennt. Doch in Jesus ist das zusammengekommen und so gilt dies nun auch für uns alle!
Wenn wir diese Gnade begreifen, dann wird uns das verändern und zu Menschen machen, die mit frohem Herzen immer mehr danach streben werden, Jesus immer ähnlicher zu werden und das tun wir eben unter anderem dadurch, dass wir das Wort Gottes begierig in uns aufnehmen.
Die Verse 11 und 12 sind eine Art Überschrift und Einleitung für einen längeren Abschnitt, in dem Petrus nun erklärt, wie Christen in der Welt leben sollen. Bisher hat er ja betont, dass unser Glaube ein Geschenk Gottes ist und dass uns dieser eben auch zur Herrlichkeit bringen wird. Dabei gab es bereits den allgemeinen Aufruf zum Streben nach Heiligung, gerade eben auch für unsere Zeit, die wir noch auf Erden als Fremdlinge verbringen. Ab Vers 11 geht es nun darum, wie wir das konkret in verschiedenen Lebensbereichen tun können. Dabei soll unser Verhalten zum einen Gott ehren, zum anderen aber gerade auch der Welt Zeugnis geben von Gott, was ja wiederum auch Gott ehrt.
So sehen wir in Vers 11 eine Ermahnung, dass wir uns nicht „fleischlichen“ (sündigen) Begierden hingeben sollen. In Vers 12 wird dann positiv betont, dass wir ganz bewusst unter den Heiden ein rechtschaffendes Leben führen sollen, so dass unsere Werke letztendlich dazu führen, dass die Heiden unseren Gott erkennen und somit „Gott preisen am Tag der Heimsuchung.“
Ab Vers 13 geht es dann konkret um das Verhalten gegenüber staatlichen Obrigkeiten. Wir sollen diese ganz bewusst anerkennen im Wissen darum, dass diese letztendlich auch unter der Obrigkeit Gottes stehen. Als „Knechte Gottes“ sollen wir also alle geringeren Obrigkeiten, die ER letztendlich dort hingestellt hat, anerkennen. Das kann natürlich niemals „blinder Gehorsam“ sein, der uns dazu veranlassen würde auf Befehl hin zu sündigen. Aber es sollte ein Gehorsam sein, der auch mal persönliche Nachteile in Kauf nimmt.
Ab Vers 18 geht es dann konkret um die Beziehung zu Menschen, die eine gewisse Autorität über uns haben. Hier geht es um Herren und Knechte – was letztendlich eine gewisse Ähnlichkeit zu der heutigen Situation von Mitarbeitern und Vorgesetzten hat. Auch diesen Autoritäten sollten wir grundsätzlich gehorchen und auch hier sollten wir ggf bereit sein, gewisse Ungerechtigkeiten und Leid zu ertragen. Damit erweisen wir uns als wahre Nachfolger des Herrn Jesus Christus, dem es da ja nicht besser erging.
- Diese Aufrufe sind natürlich extrem herausfordernd. Aber andererseits sind sie großartige Gelegenheiten dazu, Zeugnis von unserem Glauben zu geben. Wir vertrauen auf einen allmächtigen Herrn, der eines Tages alles gerecht richten wird. Wir müssen uns deshalb nicht „unser Recht“ erkämpfen, denn das macht der HERR für uns – und ER kann das viel besser als wir!
- Außerdem erkennen wir bewusst an, dass wir Menschen sind, die Autorität achtet. Wir wissen darum, dass wir einen HERRN haben und streben eben nicht mit aller Macht nach einer Unabhängigkeit, die es letztendlich ohnehin nicht gibt und die auch nicht gut für uns wäre.
Die ersten 7 Verse von Kapitel 3 setzen im Prinzip die Anwendungen aus der 2. Hälfte von Kapitel 2 fort. So wie Christen aufgerufen sind, sich stattlichen und beruflichen Autoritäten unterzuordnen auch wenn diese Ungläubige sind, so sollen sie das auch im privaten Umfeld tun. Dabei spricht Petrus hier konkret Frauen an, die in der Ehe zum Glauben gekommen sind. Die natürliche Tendenz könnte dann sein, dass sie ihre Männer ständig evangelisieren. Petrus hält dagegen, dass das bessere Zeugnis einfach das konsequente christliche Leben ist. „Ohne Worte“ bedeutet aber sicher nicht, dass Frauen nie das Evangelium sagen sollen – aber das sollte eben nur sehr gelegentlich geschehen. Die gleichen Worte ständig wiederholt sind weniger überzeugend, als das konsequent gelebte Zeugnis.
Die Aufforderung an die Männer ist etwas weniger klar – vom Gesamtkontext her müsste man denken, dass es sich an Männer richtet, die in der Ehe zum Glauben gekommen sind und ungläubige Frauen haben – aber dies scheint hier nicht der Fall zu sein. Vielmehr spricht Petrus hier wohl grundsätzlich alle christlichen Ehemänner an. Das vielleicht auch deshalb, weil Männer die Aussagen davor dazu missbrauchen könnten, um ihre Frauen mit Druck zur Unterordnung aufzufordern. Das sollten Männer nicht tun, denn die Worte des Petrus (wie auch die des Paulus an anderer Stelle) richten sich halt nur an die Frauen. Den Ehemännern wird hier gesagt, dass sie ihre Frauen ehren sollen und anerkennen sollen, dass die Frauen gleichberechtigte „Miterben der Gnade des Lebens“ sind. Jedes falsche Machtspielchen ist deshalb sündig und hindert, den Glauben zu leben. Das (gemeinsame) Gebet leidet immer da, wo keine Harmonie herrscht.
Trotzdem sollten Ehepaare sicher auch dann (oder besser – gerade dann) miteinander beten, wenn sie Streit hatten und eben ihre Rollen nicht so gelebt haben, wie sie es sollten.
Was Petrus hier auf jeden Fall zeigt ist, dass wir Christen in allen Lebensbereichen immer wieder danach fragen sollten, wie wir bewusst als Christen Zeugnis geben können und wie wir in allen Dingen Gott-gefällig leben können.
- Möge der Herr uns da Weisheit geben!
Der Fokus ab Vers 8 ist zum einen das Miteinander in der Gemeinde – evtl wird hier der Gedanke aus Vers 7 fortgeführt, wo es ja um das Miteinander von Mann und Frau in der Ehe ging – zum anderen geht es hier dann aber auch weiterhin darum, wie wir als Christen in der Welt leben sollen.
Das Psalm-Zitat in Vers 12 ist bedenkenswert. Wer sind die „Gerechten“ von denen hier die Rede ist? Letztendlich können das nur die sein, die aus Gnade, durch Glauben mit der Gerechtigkeit Christi umkleidet sind. Das heißt, es ist hier nicht primär ein Zustand, den wir erreicht haben, sondern etwas, das Christus für uns getan hat. Doch als so „gerecht gemachte“ sollen wir nun auch so leben und dem Frieden nachjagen, und im Gebet zu Gott kommen und dem Guten nacheifern.
- Ein solches Leben kann Widerstand hervorrufen, Vers 14 ist da vollkommen klar. Doch wie Jesus selbst in der Bergpredigt, so lehrt auch Petrus hier, dass Leiden um des Glaubens willen letztendlich Segen mit sich bringt.
Vers 15 zeigt uns, wie wir in angefochtenen Zeiten fest im Glauben stehen können: „heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen“, d.h. wir sollen uns bewusst auf Christus besinnen und unserem Glauben Raum geben … so werden wir dann auch in schweren Zeiten eine feste Hoffnung haben und bereit dazu sein, diese Hoffnung auch zu bezeugen.
Schließlich betont Petrus, was er auch schon den Frauen gegenüber angedeutet hatte. Unser Zeugnis soll nicht aus vielen Worten bestehen und nicht aggressiv sein – wir wollen unseren Glauben mit Sanftmut und Gottesfurcht bezeugen, d.h. wir wollen eben nicht die Menschen fürchten, sondern bewusst auf Gott sehen. Genau das wird dann letztendlich auch dazu führen, dass unsere Ankläger keine guten Argumente haben werden. Das Ziel eines solchen Lebens wird in Kap. 2,12 beschrieben: „führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung.“
Auch wenn Menschen sich nicht Gott zuwenden, sollten wir unser Zeugnis klar leben. Denn es hat eine Doppelfunktion. Wir beten dafür, dass Menschen so zur Erkenntnis der Wahrheit kommen … aber andere werden das erleben, was Vers 15b-16 beschreibt: „. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zuschanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen.“
Der Abschnitt endet mit einer interessanten Gegenüberstellung, die letztendlich impliziert, dass wir – so oder so – leiden werden. Die Frage ist nur wofür … „es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet als um böser Taten willen.“
- Möge der Herr uns in unserem Leben und Zeugnis stärken, so dass wir in Seinem Willen wandeln … dem Frieden nachjagen, im Gebet zu Gott kommen und dem Guten nacheifern … und gerade darin Gottes Segen finden!
Vers 18 bildet die Brücke zu dem Abschnitt davor und dem, was jetzt kommt. Unser ganzes Verhalten soll sich an dem von Jesus Christus orientieren, der eben auch gelitten hat. Dabei wird hier schon deutlich, dass ER sowohl Vorbild, wie auch einzigartiger Erlöser ist, der als Gerechter für die Ungerechten gestorben ist und uns zu Gott führt als der, der nach dem Fleisch getötet wurde, aber nach dem Geist lebendig gemacht wurde.
Dann kommt eine Aussage, die sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Christus ist „durch den Geist“ lebendig gemacht worden … und im Geist (also nicht im Fleisch) hat Jesus auch schon zu AT Zeiten seinen Dienst versehen, denn er ist ja der ewige Sohn Gottes. Er hat auch damals schon – zur Zeit Noahs – den Menschen gepredigt (durch das Zeugnis Noahs), die ihn ablehnten und deshalb nun „Geister im Gefängnis“ sind. Das heißt, auch damals schon haben Menschen die Heilsbotschaft abgelehnt und die verspottet, die im Glauben auf Gott gelebt haben – so wie es Noah tat.
Petrus zeigt damit, dass das was er in Vers 17 fordert, kein neues Phänomen ist (Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, daß ihr um guter Taten willen leidet als um böser Taten willen.) Damals, wie heute, werden einige durch die Heilsbotschaft gerettet, während sie anderen zum Gericht dient.
Und die damalige Flut war ein Vorbild der Taufe – gleiches ließe sich auch über die Flucht Israels durch das Rote Meer sagen … Menschen kommen durch das Wasser aus dem alten Leben heraus, und werden so von Gott gerettet. Das ist es, was in der Geistes-Taufe geschieht und was dann in der Wassertaufe bezeugt wird.
- Die Taufe, die rettet, ist die Geistestaufe … und im Prozess der Bekehrung bringen wir Gott ja auch unsere Schuld und bitten so um ein gutes Gewissen.
Wie zu Beginn des Abschnitts lenkt Petrus zum Abschluss unseren Blick wieder auf Jesus, der als durch den Geist lebendig gewordener nun zur Rechten Gottes des Vaters sitzt und über alle und alles regiert!
Zu Beginn des Kapitels lehrt Petrus nochmals (wie schon am Ende von Kap. 2 und in 3,17f, dass Jesus gelitten hat und auch wir deshalb darauf vorbereitet sein sollen, auch selber zu leiden. In den Versen 1-2 geht es wahrscheinlich darum, dass derjenige, der bereit ist um Christi Willen zu leiden, letztendlich darin zeigt, dass die Sünde keine Macht mehr über ihn hat und er sich ganz in Gottes Willen gegeben hat (und deshalb sogar bereit war/ist, für Christus zu leiden).
Dann schaut Petrus zurück darauf, wie Menschen leben, bevor sie zum Glauben kommen. Diesen Dingen sollen wir nun fliehen. Doch wenn wir nach der Bekehrung diesen Lebensstil aufgeben, wird das Menschen befremden. Ihr Lästern kann uns wehtun, aber den Schaden davon haben diese Menschen letztendlich selbst, da sie eben Rechenschaft ablegen werden müssen.
Manche Gläubigen sind für ihren Glauben gestorben. Wahrscheinlich geht Petrus in Vers 6 darauf ein, ob diese Christen nun letztendlich nicht doch auf der Verliererseite stehen. Petrus betont, dass ihnen das Evangelium verkündet wurde (und sie das offensichtlich im Glauben angenommen haben), so dass sie selbst im fleischlichen Tot die Gewissheit ewigen Lebens durch das Wirken des Geistes haben. Die Hoffnung der Christen ist deshalb letztendlich unabhängig davon, ob sie leben oder (für ihren Glauben) sterben. Das Ende aller Dinge ist nahe und letztendlich leben wir auf eine Zukunft zu … das war ja auch schon der Tenor in Kapitel 1.
Ab Vers 8 ruft Petrus uns dann dazu auf, die Zeit, die uns noch auf Erden verbleibt, auszukaufen bzw so zu nutzen, dass wir Gott damit ehren und den Menschen Gutes tun.
- Für mich persönlich ist Vers 11 eine immer wieder wichtige Erinnerung daran, dass ich keine eigene Botschaft habe und diese auch nicht aus eigener Kraft verkünden muss. Ich verkünde Gottes Wort. Das ist es, was alle Menschen brauchen – das unverfälschte Wort Gottes und nicht meine menschlichen Weisheiten.
- Und Gott muss durch Sein Wort wirken. Es ist seine Kraft, die Menschen verändert. Das vermag kein Prediger.
- In diesem Sinne hoffe ich auch sehr, dass Ihr vor allem die Textabschnitte lest und nur sekundär meine Gedanken dazu … wenngleich ich mich darum bemühe, dass meine Gedanken dabei dienen, Gottes Wort noch besser zu verstehen.
Mit dem Abschnitt ab Vers 12 endet der Hauptteil des Briefes, bevor dann in Kapitel 5 abschließende Ermahnungen, Belehrungen und Grüße angeführt werden. Petrus ermutigt nochmals die Gläubigen, die um des Glaubens willens leiden. Er betont, dass uns dies nicht befremden sollte, denn es gehört zum Leben als Christ dazu, da ja auch der Christus gelitten hat. Doch nach dem Leid kommt die Herrlichkeit und Petrus lenkt unseren Blick wiederum darauf. In Vers 14 greift er dann scheinbar Worte vom Beginn der Bergpredigt auf.
Ab Vers 15 macht Petrus dann deutlich, dass es natürlich auch Leiden gibt, die nichts mit unserer Nachfolge des Herrn zu tun haben, sondern die Konsequenz sündhaften Lebens sind.
- Wir sollten uns im Leiden immer wieder fragen warum wir leiden. Leiden wir für Christus und deshalb, weil wir gerade nicht so leben, wie wir es als Christen sollten?
- Die gleiche Frage könnte man auch anders herum stellen – warum leiden wir manchmal nicht? Weil Gott uns in besonderer Weise verschont oder weil wir uns dem Leiden entziehen, dass wir als treue Christen ggf erfahren würden?
Petrus macht dann deutlich, dass das Gericht bald beginnt. Dabei werden wir Christen natürlich nicht im letztendlichen Sinne aufgrund unserer Werke gerichtet … Rettung kommt aus Gnade und beruht allein auf Jesu Werk. Und doch werden ja auch unsere Werke eines Tages gerichtet werden. Als Christen wissen wir, dass wir nur gerettet werden, weil jemand anderes uns freikauft. Denen, die nicht zu Christus gehören wird es da viel schlechter ergehen, denn sie sind genauso schuldig vor Gott, wie wir alle, aber ohne stellvertretendes Opfer und Fürsprecher …
- Wir dürfen aber wissen, dass wenn Gott uns im Gericht gnädig sein wird, er auch hier auf Erden für uns sorgen wird. Deshalb sollen wir IHM in allem Leid unsere Seelen anbefehlen und IHM vertrauen.
Zu Beginn von Kapitel 5 schreibt Petrus als Mit-Ältester, Zeuge der Leiden Christi und Teilhaber an der zukünftigen Herrlichkeit an andere Älteste. Einerseits adressiert er sie damit nicht von „oben herab“, sondern auf Augenhöhe als Mit-Ältester, obwohl er sich ja auch zurecht als Apostel titulieren könnte. Andererseits betont er damit seine Autorität als Zeuge, der Leiden Christi. Er hat die Leiden Christi selbst erlebt (und somit sind seine Worte über das Leid nicht nur ‚Theorie‘). Aber vor allem ist er sich eben auch der zukünftigen Herrlichkeit gewiss.
Dann spricht er konkret seine Mit-Ältesten an und erklärt ihnen, wie sie ihr Amt und ihre Berufung leben sollen. Sie sollen die Herde Gottes weiden … und damit erkennen, dass dies nicht ihre eigene Herde ist.
- Gott hat den Ältesten (dieses Wort wird austauschbar auch mit Bischof & Pastor gebraucht) die Herde anbefohlen und so soll diese Aufgabe aus vollem Herzen zur Ehre Gottes und zum Wohl der Herde ausgeübt werden.
- Wer das tut darf darauf vertrauen, dass dieser Dienst von Gott honoriert werden wird.
Die Jüngeren werden dann dazu aufgerufen, sich den Ältesten unterzuordnen. Hier könnten theoretisch einfach ältere Geschwister gemeint sein, aber der Kontext legt nahe, dass es sich wohl um die Ältesten der Gemeinde handelt. Jüngere Menschen könnten dazu versucht sein, die Älteren gering zu achten und sich selbst sehr wichtig zu nehmen. Petrus warnt vor solchem Hochmut und ruft uns zur Demut auf.
- Wenn wir uns demütigen, wird Gott uns zu seiner Zeit erhöhen. Wenn wir uns jedoch zu wichtig nehmen kann es vorkommen, dass Gott uns auch mal demütigt …
Ab Vers 7 macht Petrus allen Christen nochmals Mut. Wir dürfen unseren Sorgen an Gott abgeben. Und er ruft uns zur Wachsamkeit und Leidensbereitschaft auf. So geben wir Satan dann keinen Raum. Stattdessen sollen wir uns auf Gott besinnen: „Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen.“
- Ihr Lieben – das wünsche ich uns allen … dass wir immer wieder den Blick auf Gott richten und so in unserem Vertrauen auf IHN gestärkt werden!